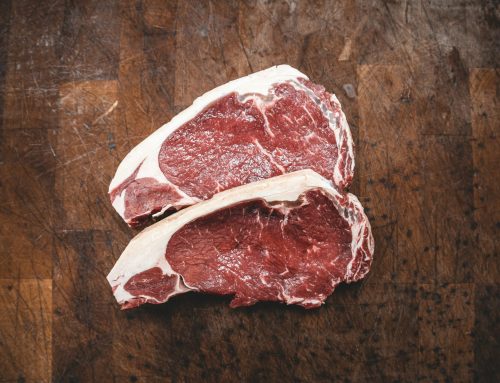[NEWS] Luxemburger Wort – Neuausrichtung im Antidopingkampf: So werden die besten Luxemburger kontrolliert
13 février 2025
Joe Geimer journaliste Luxemburger Wort
Die einheimischen Topathleten werden in zwei Gruppen eingegliedert. Wie oft werden Sie getestet? Und was kostet eine Kontrolle?
Luxemburgs beste Sportler werden in Sachen Dopingbekämpfung nicht mehr alle gleich behandelt. Was verwirren mag, macht durchaus Sinn. Die nationale Antidopingbehörde (ALAD) hat ihr Kontrollsystem angepasst. Es ist nun gerechter und besser an den individuellen sportlichen Werdegang eines jeden Athleten angepasst. Es wird nicht weniger kontrolliert. Nur gezielter.
Loïc Hoscheit ist seit Oktober 2023 Vorsitzender der Luxemburger Behörde, die ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, genauer in Pulvermühle, hat. Er erklärt: „Bislang war es so, dass ein Sportler, der im COSL-Elitekader und/oder in der Elitesportsektion der Armee engagiert war, automatisch zum Groupe cible (auf Englisch RTP: Registered Testing Pool) der ALAD gehörte. Für diese Sportler aus dem Testpool wurden einheitliche Regeln angewandt. Das hat bis vor ein paar Jahren gut funktioniert, weil es sich um eine übersichtliche Anzahl an Personen handelte. Mittlerweile ist die Anzahl von 35 auf fast 75 angestiegen. Das ist ein nicht unerheblicher Mehraufwand auf administrativer Ebene und deswegen kompliziert.“
Ein weiteres Problem wurde offensichtlich. „In so einer großen Gruppe kann es keine Einheitlichkeit geben. Es gibt dort Sportler, die sich auf Olympia oder andere Topevents vorbereiten und international zu den Top 20 ihrer Disziplin gehören. Andere sind 18 oder 19 Jahre alt und ehrgeizige, ambitionierte Sportler. Aber sie versuchen beispielsweise durch die Armee den Sprung in den Profibereich zu schaffen. Ist es für diese beiden Extreme sinnvoll, dieselben Antidopingregeln geltend zu machen? Um es gerechter zu machen, sich an die einzelnen Realitäten der Sportler anzupassen und intern besser arbeiten zu können, gehen wir seit dem 1. Januar den Weg, der von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) empfohlen wird, und haben zwei Gruppen eingeführt“, verrät Hoscheit.
Der 34-Jährige ergänzt: „Für die Sportler im Groupe cible ändert sich absolut gar nichts.“ Dazu gehören die nationalen Elitesportler. Diese Athleten müssen an jedem Tag des Jahres ein einstündiges Zeitfenster (zwischen 5 und 23 Uhr) angeben, während dem sie an einem von ihnen festgelegten Ort kontrolliert werden können. Die Geolokalisierung ist zweifelsfrei auch ein Einschnitt in die persönliche Freiheit. Hinzu kommt der Groupe de contrôle (auf Englisch: Testing Pool). Dazu gehören die jungen Sportler, die sich nach oben arbeiten möchten und Athleten, die zwar nicht auf internationaler Ebene ganz vorne mitmischen, allerdings national gut unterwegs sind.
Zwei fundamentale Unterschiede
Es herrschte recht schnell ein Konsens. Die Reaktionen der Sportler und Verbände waren positiv. Für die jungen Athleten ist es wichtig, dass sie nicht direkt die volle Wucht des internationalen Antidopingkampfs zu spüren bekommen, sondern behutsam an ihre Verpflichtungen herangeführt werden.
„Die Schwierigkeit besteht darin, das komplexe System in seinem ganzen Ausmaß zu verstehen. Es geht nicht nur darum, nicht zu dopen. Es gibt eine ganze Reihe anderer Punkte, die man im Blick haben muss: Es gibt eine Liste von verbotenen Medikamenten, es gibt Ausnahmebewilligungen zu therapeutischen Zwecken, es gibt die Whereabouts-Regeln im ADAMS-System. Für junge Sportler ist es wichtig, dass sie an die Hand genommen werden“, weiß Hoscheit.
Die beiden Listen werden zwei- oder dreimal im Jahr angepasst und aus Transparenzgründen auf der ALAD-Internetseite veröffentlicht. „Der große Unterschied zwischen den beiden Gruppen besteht darin, dass die Sportler aus dem Testing Pool kein einstündiges Zeitfenster am Tag angeben müssen, an dem sie kontrolliert werden können. Wir benötigen eher die Trainingszeiten oder die Zeiten, an denen eine Person an der Universität ist.“
Auch wichtig: „Wenn diese Sportler nicht anwesend sind, bekommen sie nicht sofort einen Verstoß aufgeschrieben. Wenn das Fehlverhalten jedoch regelmäßig auftritt, erfolgt als Konsequenz die Zugehörigkeit zum Registered Testing Pool. Und dann sind die Verpflichtungen und die Konsequenzen beim dritten Vergehen innerhalb eines Jahres ganz andere. Es erfolgt eine Sperre.“
Seitens der ALAD existiert ein Kontrollplan für das gesamte Jahr, basierend auf den Saisonplanungen der Sportler, ihren geplanten Trainingslehrgängen, den anvisierten sportlichen Höhepunkten im Jahr und den je nach Sportart unterschiedlichen Risiko-Substanzen. Hoscheit ergänzt stolz: „Wir haben ein neues Kapitel aufgeschlagen. Dabei geht es um die Kollektivsportarten. Die ALAD war historisch zwar bei Pokalendspielen präsent, aber nur selten bei Meisterschaftsspielen. Und auch nur wenig bei Trainingseinheiten. Das wollen wir ändern.“
Es geht dabei auch um Lehrgänge der Nationalmannschaften. „Wir bekommen die Termine der vier großen Kollektivsportarten. Das ermöglicht uns, sie gezielt zu kontrollieren. Man darf nicht vergessen: Die Sportler werden auch in den Ländern, in denen ihre Clubs spielen, von den nationalen Antidopingbehörden kontrolliert.“
Auf Vereinsebene ist nicht vorgesehen, dass beispielsweise die Vereine aus der BGL Ligue im Training kontrolliert werden. Bei den Meisterschaftsspielen ist das anders. „Das nationale Spielniveau verlangt, dass wir ein bisschen genauer hinschauen. Die Spieler werden ordentlich bezahlt. Der Druck ist vorhanden. Überall, wo Geld fließt, besteht ein potenzielles Risiko. Ich möchte allerdings niemandem etwas unterstellen.“
Ein bisschen Fingerspitzengefühl hat die ALAD mit ihren 35 Agenten auch: „Wenn wir wissen, dass Patrizia van der Weken die ganze Woche in Luxemburg ist und sonntags das CMCM Meeting läuft, müssen wir vielleicht nicht unbedingt am Tag des Rennens morgens um 6 Uhr vor ihrer Tür stehen. Wir sind nicht da, um die Sportler zu nerven oder sie willkürlich in der Vorbereitung zu stören. Unsere Arbeit ist es, die Athleten zu begleiten, ihnen zu helfen und zu zeigen, wie das System funktioniert. Wir wollen den Sportlern die Möglichkeit geben, zu beweisen, dass sie sauber sind. Und natürlich wollen wir jemanden, der sich nicht an die Regeln hält, aus dem System bekommen. Es geht allerdings nicht darum, eine möglichst hohe Anzahl von Athleten zu sperren.“
Einige der besten Luxemburger Sportler und Sportlerinnen leben im Ausland, sind bei Wettkämpfen in der ganzen Welt unterwegs und dementsprechend nur selten in Luxemburg. Das bedeutet nicht, dass die ALAD passiv zuschaut.
Hoscheit klärt auf: „Bei den Wettkämpfen haben wir keine Autorität. Das macht der Organisator oder die nationale Antidopingbehörde. Wenn wir beispielsweise Jeanne Lehair kontrollieren möchten, können wir die französische Behörde (AFLD) beauftragen, das in unserem Namen zu machen. Sie kümmern sich um alles und schicken die Proben ins Labor. Wenn die AFLD aus Termin- oder Personalgründen nicht kann, können wir mit privaten Anbietern zusammenarbeiten. Das wird regelmäßig gemacht.“
Organisatorisch und finanziell ist diese Prozedur allerdings ein Mehraufwand. „Wenn wir hier eine Kontrolle machen, bei der nur Urin und kein Blut entnommen wird und in Köln eine Standarduntersuchung im Labor anordnen, kostet der ganze Prozess 160 bis 170 Euro. Hinzu kommt der Transport. Der kostet 350 Euro. Wenn Urin und Blut entnommen wird und die Analysen im Labor präziser und detaillierter sind, bewegen wir uns gleich bei 500 bis 600 Euro ohne Transport. Im Ausland sind wir ganz schnell bei 1.500 Euro und mehr“, erklärt der ehemalige Handballer.
Harmlose Kontrollen
Die Kontrollen verlaufen in der Regel ohne größere Hürden. „Allgemein sind die Erfahrungen positiv. Die meisten Sportler geben freiwillig das Zeitfenster zwischen 6 und 7 Uhr als möglichen Kontrolltermin an. Sie wissen, dass sie dann im Bett liegen und riskieren demnach nicht, eine Kontrolle zu verpassen. Dann werden sie halt zwei, drei, viermal im Jahr von uns aus dem Bett geklingelt. Da gab es noch nie größere Probleme. Nach der ersten Tasse Kaffee geht die Kontrolle meist reibungslos vonstatten. Die Sportler machen das in Luxemburg wirklich mit einer vorbildlichen Einstellung“, lobt Hoscheit.
Der ehemalige Schüler des Lycée Aline Mayrisch, der in Paris Sportmarketing und Management studierte, verrät: „Um zum Registered Testing Pool zu gehören, soll man mindestens dreimal im Jahr kontrolliert werden. Es kann öfter sein, wenn wir das Gefühl haben, dass das nötig ist. Hier reden wir nur von den Kontrollen der ALAD. Bei den Olympia-Kandidaten machen auch die internationalen Verbände, oft über die International Testing Agency (ITA), drei- oder viermal im Jahr Kontrollen. Zudem werden diese Sportler bei den Wettkämpfen untersucht. Dann kommt man bei den Luxemburger Topsportlern im Schnitt auf zehn bis 15 Kontrollen im Jahr.“
Die ALAD ist mit ihren fünf festen Mitarbeitern in ihrem Aktionsraum begrenzt. Mittelfristig soll das Personal verdoppelt werden. Und somit wahrscheinlich auch die Anzahl des Tests. 2023 führte die ALAD 232 Analysen durch. Alle waren negativ. Daran ändert hoffentlich auch die Neuausrichtung nichts.